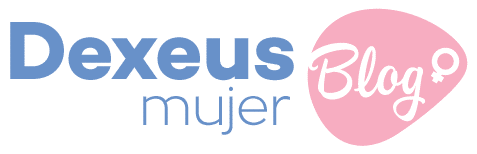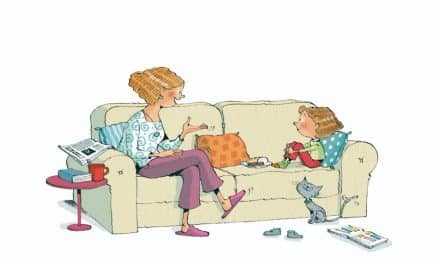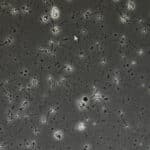In der Regel werden Fruchtbarkeitstests bei Patientinnen durchgeführt, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Sie können aber auch sinnvoll sein, wenn es in der Familienanamnese Fehlgeburten oder andere gynäkologische Probleme gibt, wenn man die Familienplanung aufschieben möchte oder eine zukünftige Mutterschaft nicht ausschließt. Ziel eines Fruchtbarkeitstests ist es, zu überprüfen, ob alles richtig funktioniert, und die Chancen auf eine Schwangerschaft einzuschätzen.
Fruchtbarkeitsprobleme treten häufiger auf, als man denkt. Etwa 15?% der Paare sind betroffen, und in rund 30?% der Fälle liegen die Ursachen sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Der Vorteil einer frühzeitigen Untersuchung ist, dass im Falle eines Befunds die Behandlung schnell eingeleitet werden kann und gleichzeitig mehr Zeit für weitere Entscheidungen bleibt.
Was wird untersucht? Ist der Prozess lang oder kompliziert?
„Normalerweise, wenn keine besonderen Untersuchungen notwendig sind, ist der Test unkompliziert, und die Ergebnisse liegen bereits nach einigen Wochen vor“, erklärt Dr. Marina Solsona, Spezialistin für künstliche Befruchtung bei Dexeus Mujer. „Zunächst findet ein Erstgespräch statt, in dem der allgemeine Gesundheitszustand sowie Ernährungsgewohnheiten, Lebensstil und die medizinische Vorgeschichte der Patientin besprochen werden.“ Außerdem werden eine Blutuntersuchung zur Bestimmung des Hormonspiegels, eine körperliche Untersuchung, eine Zytologie zum Ausschluss möglicher Entzündungen oder Zellveränderungen und ein vaginaler Ultraschall durchgeführt. Bei Patientinnen über 40 Jahren kann zusätzlich eine Mammographie oder eine Brustsonographie sinnvoll sein. Wenn man einen männlichen Partner hat, wird bei uns auch ein gemeinsamer Fruchtbarkeitstest angeboten.
Welche Daten sind am wichtigsten? Welche Aspekte berücksichtigen Fachleute, um eine gründliche Einschätzung zu geben? Jeder Fall wird individuell betrachtet, sodass die Untersuchungen an die Bedürfnisse jeder Patientin angepasst werden. Es gibt jedoch einige allgemeine Routineuntersuchungen, die in der Regel durchgeführt werden. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche das sind:
- Bestimmung der ovariellen Reserve
Dazu wird zwischen dem dritten und dem fünften Tag des Menstruationszyklus eine vaginale Sonographie durchgeführt. Dabei wird die Anzahl der Follikel in jedem Eierstock bestimmt. Die antralen Follikel werden auch Eibläschen genannt und enthalten jeweils eine unreife Eizelle. Wenn in beiden Eierstöcken zusammen mehr als zehn Follikel gezählt werden, ist die Reserve in Ordnung. Liegen in einem Eierstock vier oder weniger Eizellen oder insgesamt nur sieben, spricht man von einer verminderten ovariellen Reserve. Das bedeutet jedoch nicht, dass keine Schwangerschaft möglich ist oder die Eizellen von minderer Qualität sind.
- Hormonspiegel von AMH, LH, FSH, Progesteron und Östradiol
Die Bestimmung des Hormonspiegels ist entscheidend, um mögliche endokrinologische Störungen zu erkennen, die den Menstruationszyklus beeinflussen können, und um die ovarielle Reserve einzuschätzen. Dabei werden folgende Hormone analysiert:
– Anti-Müller-Hormon (AMH): Dieses Hormon wird von den Follikeln gebildet. Ein hoher Spiegel (über 3,1 ng/ml) deutet auf eine gute ovarielle Reserve hin. Ist der Spiegel niedrig (unter 1 ng/ml), gilt die Reserve als gering. Das bedeutet, dass die fruchtbare Lebensspanne der Frau kürzer sein kann.
– FSH, LH und Östradiol: Das follikelstimulierende Hormon (FSH) wählt die Follikel aus und aktiviert sie, damit sie wachsen. Das luteinisierende Hormon löst den Eisprung aus, und das Östradiol wird von den wachsenden Follikeln gebildet. Alle diese Hormone liefern wichtige Informationen zur Beurteilung der Fruchtbarkeit. Im Allgemeinen deuten FSH-Werte über 10 oder Östradiolwerte über 80 pg/ml auf eine geringe ovarielle Reserve hin, obwohl diese Werte von Zyklus zu Zyklus schwanken können, teilweise sogar mehr als die Anti-Müller-Hormon.
– Progesteron: Dieses Hormon wird vom Eierstock nach dem Eisprung gebildet. Sein Spiegel zeigt an, ob ein Eisprung stattgefunden hat oder ausbleibt (Anovulation). Angemessene Werte liegen über 5–10 ng/ml.
- Vaginale Sonographie
Dabei werden die Fortpflanzungsorgane, wie die Gebärmutter und die Eierstöcke, untersucht. Eine Sonographie ist notwendig, um mögliche Auffälligkeiten wie Myome, Polypen oder Zysten sowie strukturelle Veränderungen wie Fehlbildungen oder Funktionsstörungen der Gebärmutter zu erkennen. Außerdem kann die Anzahl der Follikel bestimmt werden, um die ovarielle Reserve einzuschätzen.
- Körperuntersuchung
Dabei werden die Brüste und der vaginale Bereich abgetastet, um Auffälligkeiten auszuschließen. Diese Untersuchung wird in der Sprechstunde durchgeführt und entspricht der Tastuntersuchung, wie sie auch bei der jährlichen gynäkologischen Kontrolluntersuchung durchgeführt wird.
Andere Untersuchungen bei Frauen
In einigen Fällen sind zusätzliche Tests erforderlich. Dies sind einige der häufigsten:
Analyse des Karyotyps: Dabei handelt es sich um eine genetische Untersuchung, bei der die Anzahl und Form der Chromosomen bestimmt werden. Ziel ist, mögliche chromosomische Anomalien zu erkennen, die Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten oder andere Störungen in der Schwangerschaft verursachen könnten.
Hysteroskopie: Bei dieser Technik wird eine Kamera durch die Scheide und den Gebärmutterhals bis zur Gebärmutterschleimhaut eingeführt. Dabei können Myome, Polypen, Fehlbildungen der Gebärmutter, verbliebene Reste nach einer Fehlgeburt oder Veränderungen festgestellt werden, die auf eine mögliche Krebserkrankung hinweisen.
Endometriumbiopsie: Dabei wird eine Gewebeprobe (Biopsie) aus der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) entnommen und analysiert. Sie ist beim Implantationsversagen angebracht, um die Empfänglichkeit der Gebärmutterschleimhaut zu beurteilen, und dient der Diagnose von Infektionen, Zellveränderungen und Anomalien wie der Endometriumhyperplasie.
Hysterosalpingographie: Diese Untersuchung ist etwas komplexer und ähnelt einer Röntgenaufnahme. Dabei wird ein jodhaltiges Kontrastmittel durch die Scheide verabreicht. Damit soll festgestellt werden, ob die Eileiter verstopft sind oder Probleme in der Gebärmutter vorliegen, die verhindern, dass die Spermien die Eizelle erreichen und befruchten können. Eine modernere Alternative ist die sogenannte Hysterosalpingo-Kontrastsonographie (HyCoSy), die Ultraschall statt Röntgenstrahlen zur Darstellung der Eileiter nutzt.